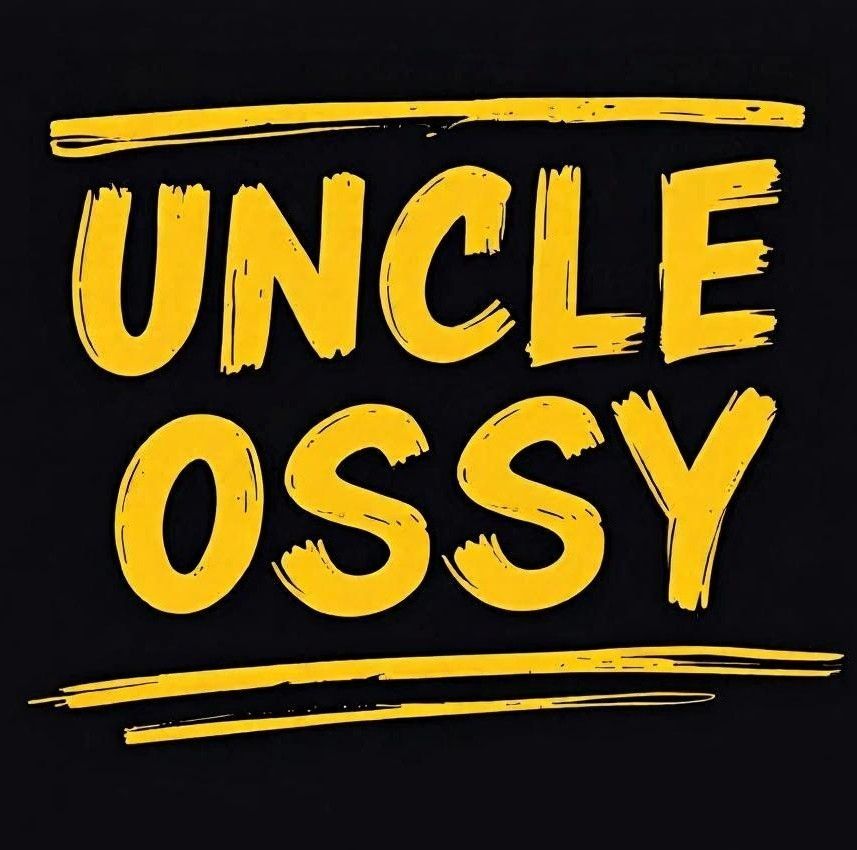Wichtige Blogbeiträge wiederholt
zu den Abschnitten
-
Wer Nichts sagtListenelement 1
Wer nichts sagt, bekommt meistens auch nichts. Das gilt auch für Personen, die die Gebärdensprache nutzen.
Ohne sich mitzuteilen (also zu kommunizieren), wissen andere nicht Bescheid.
Denn Gedankenlesen ist (noch)unmöglich.
-
Nur ein RatschlagListenelement 2
Ein Ratschlag ist ein Angebot einer Hilfe oder ein Unterstützungsangebot.
Man kann eine Ratschlag ablehnen, annehmen, missachten oder diskutieren.
Im Zweifelsfall bin ich für das Diskutieren!
-
Mit Geld HaushaltenListenelement 3
Ein Sparplan, ein Investitionsplan, ein Fahrplan für die eigene Zukunft.
Budgets einhalten ist echt schwer!
-
Motivation kommtListenelement 4
Motivation kommt nicht aus dem Nirgendwo. Eher, weil man ein bestimmtes Ziel erreichen will.
-
Warten Biss
Eine (Halb-) Wissenschaftliche Abhandlung über die Folgen der Lüge. Auch falsches Schamgefühl, Stolz oder Schüchternheit für zu den kleinen (Mini- oder Not-) oder großen (Verheimlichen, Übertreiben, Schutzschild Funktion, Böswilligkeit) Lügen. Das Ergebnis kennen die meisten Menschen selbst.
Immer noch keine Elektronik

Wenn die Erinnerung streiche spielt, ist oft keine Krankheit im Spiel sondern „Eitelkeit“.
Wenn ich Kritik an jemand anderem ausgesprochen habe, ist die erste Frage gewesen: „Wann soll ich das gesagt haben?“, „Was habe ich gesagt?“ und zwar mit dem Zusatz „genau“.
Ich mache keine Tonbandaufnahmen oder Videos von anderen Leuten um 4 Jahre später auf „Punkt, Komma, Strich“ genau wiederzugeben, was wirklich „genau“ gesagt worden und passiert ist. Der Zeitraum kann auch deutlich kürzer sein. 20Minuten?!
Und dasselbe tue ich auch nicht schriftlich. Kleine Ausnahme ist das Tagebuch, aber hier stehen eher Sachen drin, was gemacht worden ist, eher weniger was Punkt, Komma, Strich gewesen ist.
„Die Reaktion“ ist = „Das habe ich so nie gesagt“ oder „Das war am Donnerstag um 9:44 Uhr“. Bitte beachten sie die Zahl „9:44“.
Warum 44? Weil man dann implizit ein Fotografisches Gedächtnis hat. Leider ist bei mir zu sehen, wie ich den Müllcontainer fotografiert habe. Um 9:42 Uhr. In echt! Mit dem Handy!
Und jetzt?
Ganz einfach! Ich werde niemandem dieses Foto zeigen. Auch nicht der Streitbaren Person.
Warum?
Weil Zeiträume, Orte und Tätigkeiten anpassbar sind. Von 10 Minuten vorher und nachher habe ich ja kein „Beweisfoto“. Ganz ehrlich. Ich fotografiere ständig irgendwelche Sachen, wie Himmel und Erde, und ja, auch Müllcontainer!
Deswegen:
Veränderungen sind teil des Lebens. Jede davon ist eine Herausforderung. Nicht jede muss man mitmache. Aber man kann es.
Und Kritik ist nicht dazu da, jemand anderes zu verletzen, sondern um Veränderungen herbeizuführen. Denn irgendwas läuft „anders“ als man selber akzeptieren möchte.
Kritik kann man abwehren. Berechtigt oder nicht. Nur lügen sollten man dann nicht. Lügen werden von "Sich Selbst" entlarvt. Irgendwann! Und dann ist man ein Lügner! Und das ist keine Kritik mehr, sondern ein Vorwurf.
Und um das abzuwehren braucht es: Nichts! Denn der Stempel bleibt für länger…
Ossy
Wer nichts Sagt ...
... Der Schweigt ???

"Wenn Menschen sich einander mitteilen wollen, um zum Beispiel Gefühle auszudrücken oder Informationen weiterzugeben, erfolgt das über Sprache in mündlicher oder schriftlicher Form. Nur so können wir etwas erfahren und unser Wissen und Verständnis mehren. Unwissenheit und Unverständnis über einen längeren Zeitraum frustriert."
von: Erik Bartmann
Mit Arduino die elektronische Welt entdecken: 3.Auflage, Bombini Verlag, Amazon Kindel eBook, Leseposition 1221, 9% , erschienen im August 2017.
Lieber Herr Bartmann!
Sie haben in ihrem Buch etwas geschrieben im Zusammenhang mit Technik, Programmieren und so. Ich muss ihnen sagen: Ja, Kommentare sind Essenziell! Sie sind Notwendig!
Ich bin technisch durchaus begabt, aber ich glaube, Menschen werden auch "Programmiert" und dieses Programm erfordert Kommentare. Sonst versteht man (im Gegensatz zum Quellcode) von Anfang an nichts!
Ich wende dieselben Methoden und Techniken bei Menschen genauso an wie auf Schaltpläne, Aufbauanleitungen usw. an.
Leider sind Programme und Methoden (wie auch Sprünge) beim Menschen sehr schwer änderbar. Und Menschen sind sicherlich keine Elektronik oder ein Schaltplan. Aber um zu verstehen, funktioniert die selbe Vorgehensweise. Es hilft mir dabei andere Menschen zu verstehen (und ihr Verhalten).
Auch ich "teste" und "prüfe". Die Ergebnisse lassen Rückschlüsse zu (ein Voltmeter ablesen kann jeder. Aber "interpretieren" und "einordnen" kann man nur, wenn man die Schaltung und die "Werte" kennt, mit denen man Entscheidungen treffen kann: "innerhalb" oder "außerhalb" der "Toleranzangaben"). Denn bei Elektronik reicht der Blick auf dass Äußere nicht aus, um einen defekten Transistor oder Kondensator zu finden.
Mann muss in "die Tiefe gehen". Oberflächlich kann alles in Ordnung sein. Und das äußere kann täuschen. Manchmal muss man jedes Einzelteil prüfen, und selbst dann kann der Fehler wo anders liegen (äußere Umstände). Jedes "Einzelteil" ist genauso wichtig wie das "große Ganze" und die "Gesamtheit". Man darf den Überblick nicht verlieren.
Beim Menschen ist das genau so! Nur ohne Multimeter und ohne Schaltplan!
Ihre Worte sind universell und auf andere Themen sehr passend! Vielen Dank Herr Bartmann!
Liebe Grüße
Ossy
#Der Mensch muss Mensch sein, und man sollte ihn so behandeln!
Abschließen noch dass hier:
Menschenwürde, Menschenrechte
(abgeschrieben von der Webseite: https://www.bundesregierung.de/breg-de/schwerpunkte-der-bundesregierung/75-jahre-grundgesetz/artikel-1-gg-2267756)
Artikel 1 der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland
(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.
(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.
Nur ein Ratschlag.
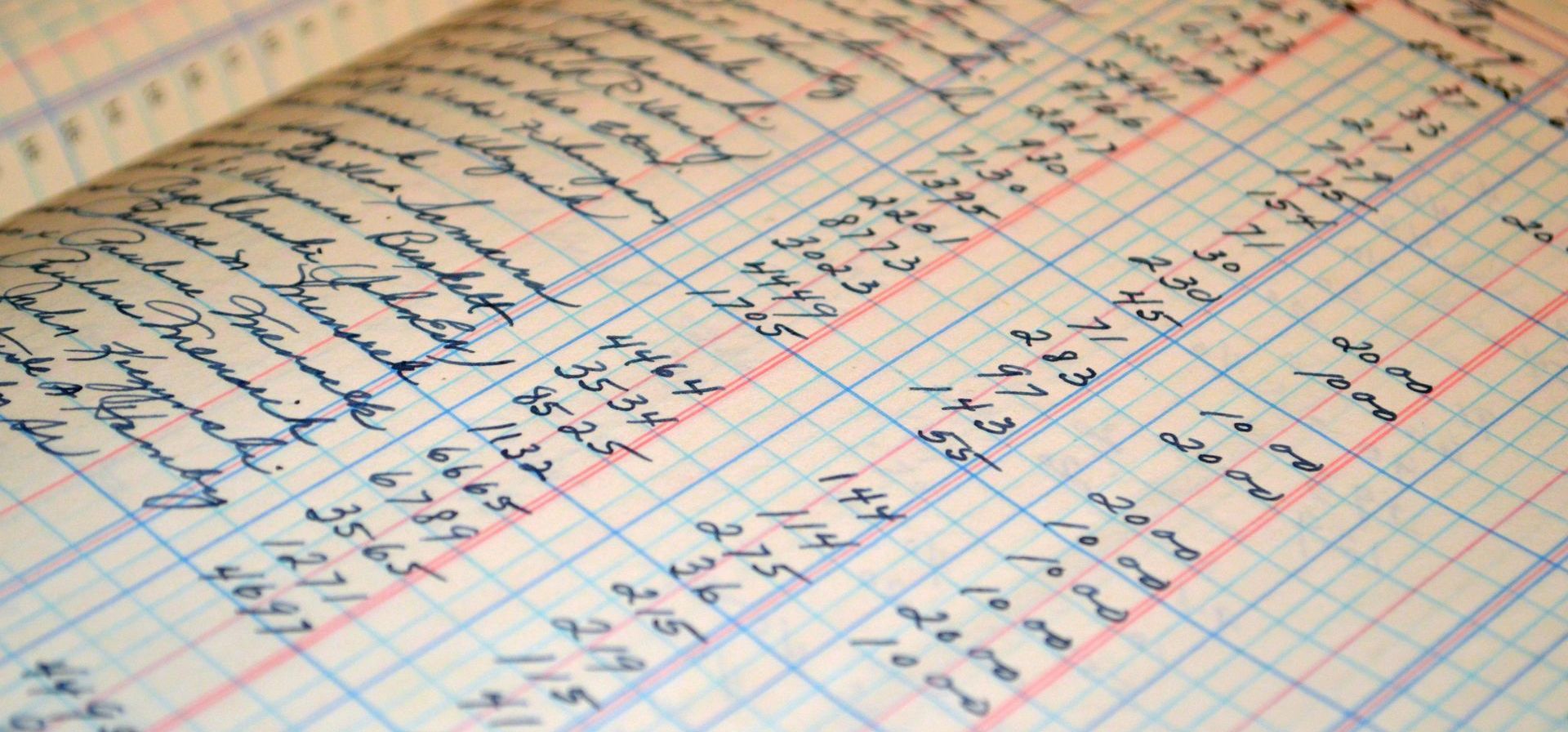
Mit Geld Haushalten
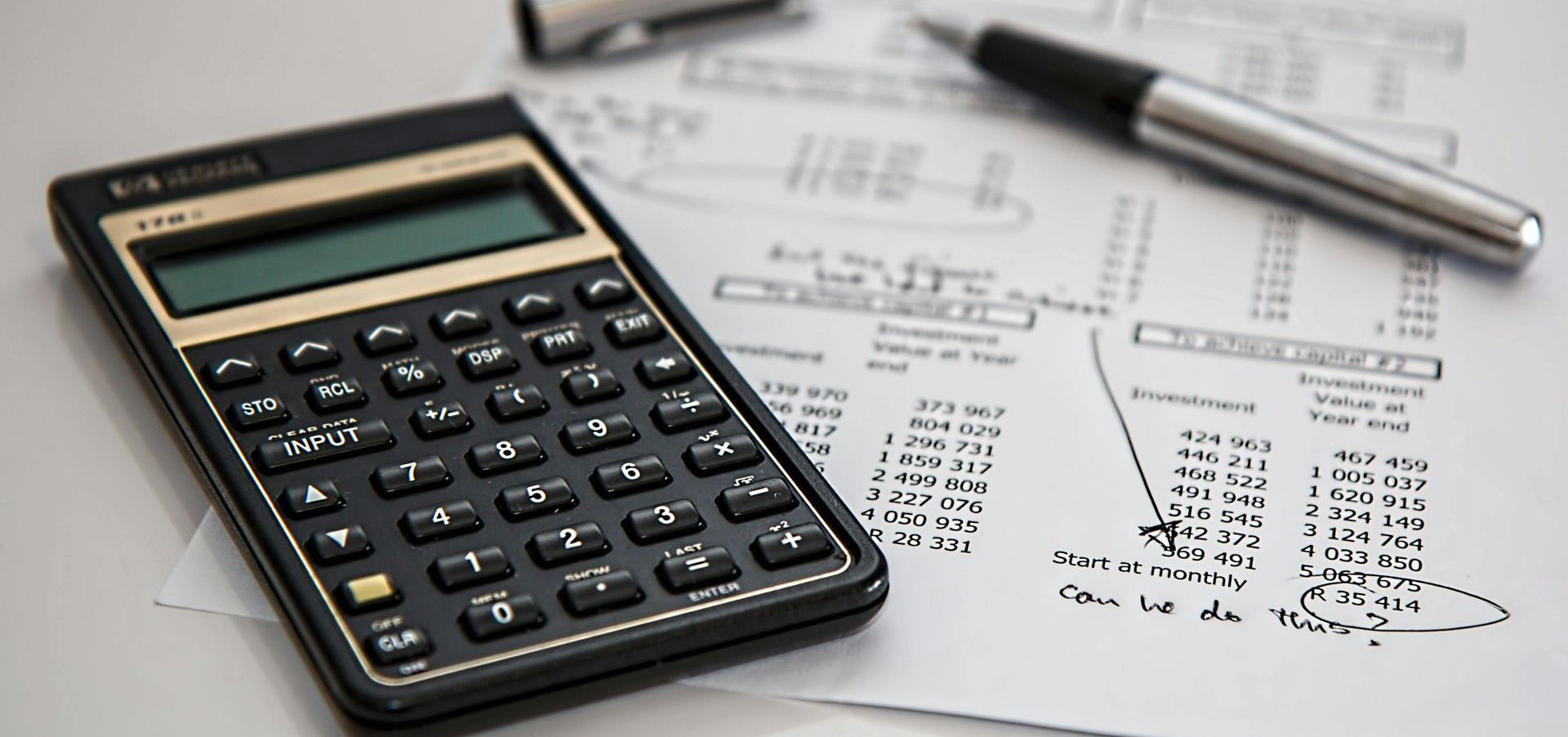
Plan für den bewussten Umgang mit Geld
Tagessätze, feste Kosten und Sparbeträge müssen selbst errechnet werden
Teil 1: Klare Schritte für den finanziellen Überblick mit einem Haushaltsbuch
1. Monatliches Einkommen und feste Ausgaben berechnen
- Schritt 1: Alle Einkommensquellen auflisten (z. B. Gehalt, Nebenjob, Kindergeld).
- Schritt 2: Alle monatlichen Fixkosten aufschreiben (Miete, Strom, Versicherungen, Abos).
- Schritt 3: Eine einfache Tabelle führen (z. B. in einem Notizbuch oder Excel), um Einnahmen und Ausgaben gegenüberzustellen.
2. Tages- und Wochenbudget erstellen
- Schritt 1: Monatliches Restbudget (= Einkommen – Fixkosten) berechnen.
- Schritt 2: Diesen Betrag durch die Anzahl der Wochen oder Tage im Monat teilen.
- Schritt 3: Einen festen Betrag pro Woche und/oder Tag festlegen, der für variable Ausgaben (z. B. Lebensmittel, Freizeit) zur Verfügung steht.
3. Budget einhalten und langsam trainieren
- Schritt 1: Tägliche Ausgaben notieren.
- Schritt 2: Woche für Woche das Verhalten beobachten.
- Schritt 3: Bei kleinen Erfolgen belohnen (z. B. ein Eis vom Wochenbudget).
- Schritt 4: Nachjustieren, wenn etwas nicht funktioniert (z.B. zu knapp geplant).
4. Regeln zur realistischen Budgetschätzung
- Regel 1: Lieber großzügig bei Lebensmitteln und Energie kalkulieren.
- Regel 2: Immer 10–15 % als Puffer einplanen.
- Regel 3: Erfahrungswerte nutzen: Was hat der letzte Monat gekostet?
- Regel 4: Unerwartete Ausgaben (z.B. Geburtstagsgeschenke) nicht vergessen.
5. Sparen als Motivation und Herausforderung
- Schritt 1: Kleines, klares Ziel setzen (z. B. 50 € pro Monat für Urlaub).
- Schritt 2: Sparbetrag direkt nach Gehaltseingang „weglegen“ (z. B. aufs Sparkonto).
- Schritt 3: Erfolge feiern, auch bei kleinen Fortschritten.
- Schritt 4: Sparen als positives Spiel sehen: „Wie viel kann ich diesmal schaffen?“
6. Rücklagen für Notfälle bilden
- Schritt 1: Monatlich einen kleinen Notfallbetrag einplanen (z. B. 20–50 €).
- Schritt 2: Extra-Konto oder Umschlagmethode nutzen (Geld sichtbar zur Seite legen).
- Schritt 3: Notfälle klar definieren (z. B. Reparatur, hohe Stromnachzahlung).
- Schritt 4: Notfall Topf unangetastet lassen – nur im „echten“ Fall nutzen.
7. Von Kontostands-Stress zu Verantwortung
- Schritt 1: Regelmäßig Konto prüfen, aber sachlich bleiben.
- Schritt 2: Wochenbudget als sportliche Challenge sehen – nicht als Einschränkung.
- Schritt 3: Kleine Rückschläge nicht überbewerten.
- Schritt 4: Verantwortung übernehmen: Geldverhalten bewusst steuern, nicht vermeiden.
Tagesgeld ohne Online‑Banking – so geht’s
Kostenloses Tagesgeldkonto eröffnen für Rücklagen / Sparen
- Damit Verfügungen schwieriger werden
- Dauerauftrag für feste Kosten pro Monat einrichten
Girokonto Karte immer zu Hause lassen, nur für Bar Abhebungen
- Damit das Geldabheben und verteilen umständlicher wird
Kontoeröffnung in der Filiale
Besuchen Sie ein Finanz‑Center (Bankfiliale). Dort können Sie das Tagesgeldkonto eröffnen – auch wenn Sie kein Online‑Banking nutzen.
Ein- und Auszahlungen
- Einzahlungen: Über Ihr Girokonto in der Filiale oder am SB‑Terminal.
- Auszahlungen: An der Kasse oder per Überweisung auf Ihr Girokonto.
Kontoauszüge & Zinsbescheinigungen
- Sie erhalten Unterlagen entweder per Post oder können die Kontoauszüge direkt in der Filiale anfordern.
Konto verwalten
- Per Besuch: Änderungen und Informationen persönlich in der Filiale oder telefonisch über die Hotline.
- Ohne Online-Banking: Keine App oder TAN‑Verfahren nötig. Sämtliche Vorgänge laufen über persönlichen Kontakt.
Beispiele für Beträge und Aufteilung
- 100€ (Notfall-) Bargeld zu Hause
- 1x Tagessatz im Portemonnaie
- der restliche Teil zu Hause
Phase 1: Bewusstsein für Geld entwickeln (1. Woche)
- Finanz Tagebuch führen: Jeden Cent notieren (Was, wann, warum)
- Reflexion: Welche Ausgaben waren notwendig? Was war impulsiv?
- Geld-Glaubenssätze erkennen und ersetzen
Phase 2: Einnahmen & Ausgaben ordnen (2. Woche)
- Tools nutzen: Notizbuch
- Einnahmen: 1300€ netto Beispiel
Kategorien erstellen:
- Miete + NK: 500€ Beispiel
- Strom/Internet/Versicherung: 100€
- Handy: 20€
- Verkehr: 80€
Hier beginnt die Tagessatz Berechnung
- Lebensmittel: 200€ - 250€
- Freizeit: 100€
Hier beginnen die Sicherheiten
- Sparen: 100€
- Rücklagen: 50€
Phase 3: Budgetierung & Sparstrategien
Beispiel:
- 50-30-20-Regel (angepasst auf 1300€ )
- 50 % Notwendiges = 650€
- 30 % Wünsche = 390€
- 20 % Sparen = 260 €
- Automatisieren: Dauerauftrag für Sparbetrag
- Sparziele setzen (Notgroschen, Urlaub etc.)
Teil 2: Erklärungen, Zusammenhänge und der Sinn dahinter
Warum mit dem Einkommen und festen Ausgaben beginnen?
Der finanzielle Überblick beginnt beim Verständnis: Was kommt rein? Was geht fix raus? Wer diese Grundlage kennt, hat den ersten Schritt zur Selbstkontrolle getan. Ohne diese Übersicht wirkt Geldfluss oft wie ein Chaos. Mit einer einfachen Liste wird klar, wie viel Spielraum übrig bleibt – das ist der Schlüssel für alle
weiteren Schritte.
Warum Wochen- und Tagesbudgets wichtig sind
Ein Monatsbudget ist oft zu abstrakt. Viele Menschen überschreiten es früh im Monat, weil sie den Überblick verlieren. Mit Wochen- oder Tagesbudgets brichst du große Zahlen auf kleine, machbare Etappen herunter. Es wird so greifbar wie ein Einkaufszettel: Du weißt, was du „ausgeben darfst“. Das macht die Planung einfacher und hilft dir, bewusster zu konsumieren.
Wie das Einhalten von Budgets gelernt wird
Budget Verhalten ist wie Muskeltraining – es braucht Wiederholung und Geduld. Anfangs vergisst man Ausgaben oder unterschätzt sie. Das ist normal. Durch tägliche oder wöchentliche Notizen und kleine Belohnungen (z. B. ein Kaffee vom gesparten Geld) wird das Verhalten mit der Zeit automatisiert. Wichtig: Statt Perfektion lieber Beständigkeit anstreben.
Was macht eine gute Budgetschätzung aus?
Ein zu enges Budget demotiviert, ein zu lockeres führt zu Frust am Monatsende. Realistische Planung ist ein Lernprozess. Die Faustregeln (10–15 % Puffer, großzügige Lebensmittel Schätzung, Rückblick auf Vormonate) helfen dir, aus Erfahrung zu lernen. Nach 2–3 Monaten hast du ein gutes Gefühl für deine wahren Kosten.
Warum Sparen zur Motivation wird
Sparen wird oft als Verzicht gesehen – dabei ist es eigentlich Zielerreichung. Wer spart, sagt: „Ich entscheide heute für mein zukünftiges Ich.“ Wenn das Ziel greifbar und positiv ist (z. B. ein Wochenendausflug oder neue Kleidung), wird Sparen zum Spiel. Die Frage „Wie viel schaffe ich diesen Monat zu sparen?“ kann Spaß machen – besonders, wenn du kleine Erfolge siehst.
Wie Rücklagen Sicherheit schaffen
Ein Notfallfonds ist wie ein Sicherheitsnetz. Er verhindert Panik bei unerwarteten Ausgaben und sorgt dafür, dass du dein Alltagsbudget nicht ruinieren musst. Wer weiß, dass z. B. 300–500 € für Notfälle bereitliegen, kann ruhiger wirtschaften. Wichtig ist die klare
Trennung von Alltagsgeld, z. B. über ein
Sparkonto oder
physisch getrenntes Bargeld.
Wie man aus Konto-Stress Verantwortung macht
Viele Menschen meiden den Blick aufs Konto, weil sie Angst haben. Doch der Kontostand ist nur eine Zahl – er beschreibt deine Lage, er bewertet dich nicht. Die Umwandlung von Angst in Handlung ist ein mentaler Schritt: Aus „Ich bin pleite“ wird „Ich habe noch 20 € – wie teile ich sie sinnvoll ein?“ Mit einem klaren Wochenbudget wird aus dem Gefühl der Ohnmacht eine sportliche Herausforderung: „Ich schaffe es, mit dem auszukommen, was ich habe.“
Fazit: Schritt für Schritt zu mehr Kontrolle
Ein Haushaltsbuch ist keine Strafe, sondern ein Werkzeug zur Freiheit. Es zeigt dir nicht nur, wo dein Geld hingeht – es zeigt dir auch, wie du es in Zukunft besser steuern kannst. Mit kleinen Schritten, realistischen Regeln und einem positiven Umgang mit Sparzielen kannst du aus deinem Alltagsspielraum echten finanziellen Handlungsspielraum machen.
Du musst
nicht perfekt starten. Aber du kannst heute beginnen.
Motivation Kommt und Geht (Wieder)
Motivation: Was uns antreibt, warum sie flöten geht – und wie wir sie zurückholen
Wir alle kennen sie. Diese Tage, an denen man morgens mit einem Lächeln aufsteht, voller Tatendrang, bereit, Bäume auszureißen – oder wenigstens das E-Mail-Postfach aufzuräumen. Und dann gibt es diese anderen Tage. Die, an denen selbst der Weg zum Kühlschrank einem Halbmarathon gleicht. Was unterscheidet diese beiden Tage?
Motivation. Dieses kleine Wörtchen mit riesiger Wirkung. Aber was genau ist Motivation eigentlich – und wie können wir dafür sorgen, dass sie nicht so oft spurlos verschwindet wie einzelne Socken in der Waschmaschine?
1. Was ist Motivation überhaupt?
Motivation ist der innere Antrieb, der uns dazu bringt, etwas zu tun. Sie ist der mentale Motor, der uns morgens aus dem Bett hebt, uns ein Ziel vor Augen führt und uns durch Rückschläge hindurchträgt (im Idealfall).
In der Psychologie unterscheidet man zwischen intrinsischer Motivation (aus eigenem Antrieb, weil etwas Spaß macht oder sinnvoll erscheint) und extrinsischer Motivation (von außen gesteuert – Belohnungen, Lob, Deadline-Druck).
Die eine ist nicht besser als die andere. Wichtig ist: Wir brauchen beides. Wer nur auf externe Belohnungen hofft, läuft schnell leer. Und wer ausschließlich auf seine innere Stimme hört, merkt irgendwann: Die hat auch nicht jeden Tag Lust.
2. Woher kommt Motivation – und wohin verschwindet sie?
Motivation entsteht, wenn wir einen Sinn erkennen. Wenn wir ein Ziel haben, das uns emotional anspricht – sei es der Sommerurlaub, ein beruflicher Erfolg oder einfach ein freier Sonntag mit Netflix und Pizza.
Doch sie ist launisch. Sie hängt von Faktoren ab wie:
- Energielevel (zu wenig Schlaf = zu wenig Bock)
- Emotionale Verfassung (Stress killt Motivation schneller als jede To-do-Liste)
- Klarheit über Ziele (Wer nicht weiß, wohin er will, wird sich kaum auf den Weg machen)
Hinzu kommt: Wir überschätzen oft unsere Dauer-Motivation und unterschätzen die Macht von Routinen. Motivation ist wie ein guter Freund – sie ist hilfreich, aber nicht immer zuverlässig. Disziplin und Struktur dagegen sind die Kollegen, die auch dann erscheinen, wenn’s regnet.
3. Warum Ziele so wichtig sind
Ziele geben uns Richtung. Ohne Ziel ist selbst die größte Anstrengung ziellos – wie Rudern auf offenem Meer ohne Kompass. Du bewegst dich, aber wohin?
Ein Ziel muss nicht immer groß sein („Ich will mein eigenes Unternehmen gründen“), es kann auch klein sein („Ich möchte jeden Tag 15 Minuten spazieren gehen“). Wichtig ist:
- Es ist konkret
- Es ist realistisch
- Es ist bedeutungsvoll für dich persönlich
Wer sich Ziele setzt, aktiviert automatisch Motivationsmechanismen. Denn unser Gehirn liebt Fortschritt – jedes erreichte Zwischenziel setzt Dopamin frei, das berühmte „Glückshormon“. Und plötzlich fühlt sich Anstrengung gar nicht mehr so schlimm an.
4. Woher Kraft nehmen für die Ziele – wenn der Akku leer ist?
„Woher nehmen, wenn nicht stehlen?“ Diese alte Redewendung trifft’s ganz gut. Motivation braucht Energie, und Energie ist begrenzt. Wer permanent „on“ ist, ohne sich zu erholen, landet irgendwann im Motivations-Notstand.
Hier ein paar echte Kraftquellen:
Schlaf: Nicht sexy, aber essenziell. Wer zu wenig schläft, kann sich schwer konzentrieren – und noch schwerer motivieren.
- Bewegung: Regelmäßiger Sport wirkt wie ein natürlicher Booster für Geist und Körper.
- Soziale Kontakte: Gespräche mit inspirierenden Menschen können Wunder wirken.
- Pausen: Ja, wirklich. Nichts tun ist auch produktiv – wenn’s bewusst geschieht.
Und ganz wichtig: Selbstmitgefühl. Niemand ist jeden Tag produktiv, kreativ und voller Energie. Wer sich selbst verzeiht, wenn’s mal nicht läuft, bleibt langfristig motivierter.
5. Realistische Bodenständigkeit – oder warum Luftschlösser selten einziehen lassen
Große Träume sind gut. Unerreichbare Erwartungen dagegen sind Gift. Viele Menschen setzen sich Ziele, die so weit von der Realität entfernt sind, dass sie eigentlich schon beim Setzen demotivieren.
Beispiel: „Ich will in einem Monat 10 Kilo abnehmen, ein Buch schreiben und Spanisch lernen.“ Klingt ambitioniert. Führt aber meist zu Frust.
Realistische Motivation beginnt mit der Akzeptanz der eigenen Umstände. Du hast einen Vollzeitjob, Familie, Verpflichtungen? Dann plane so, dass deine Ziele in deinen Alltag passen. Kleine, stetige Fortschritte bringen mehr als ein „Alles-oder-nichts“-Ansatz.
6. Neue Ideen als Motivation
Frischer Input bringt frische Motivation. Immer dieselben Abläufe, Gewohnheiten, Gespräche – das kann zur inneren Verstopfung führen (ja, auch geistig). Wer sich inspirieren lässt, findet oft neue Energiequellen.
Das kann sein:
- Ein gutes Buch
- Ein Podcast, der dich zum Nachdenken bringt
- Eine Konferenz oder ein Workshop
- Ein neues Hobby, das nichts mit Arbeit zu tun hat
Oft reicht schon ein Perspektivwechsel – ein Spaziergang, eine neue Umgebung, ein Gespräch mit jemandem, der anders denkt. Motivation lebt von Abwechslung.
7. Neue Wege gehen – auch wenn’s manchmal querfeldein ist
Motivation kommt oft, wenn wir neue Wege beschreiten. Das Problem: Neue Wege sind unbequem. Unbekanntes macht Angst. Unser Gehirn liebt Sicherheit, nicht Veränderung. Aber: Ohne Veränderung keine Entwicklung.
Wer immer das tut, was er schon kann, wird nie herausfinden, wozu er sonst noch fähig ist.
Also: Manchmal lohnt sich das Risiko. Der berufliche Wechsel, das Projekt, das schon lange in der Schublade liegt, die verrückte Idee, die du bisher belächelt hast. Ja, es könnte schiefgehen. Aber was, wenn nicht?
Mut ist oft der beste Motivator – auch wenn der Weg nicht geradeaus verläuft.
8. Erfahrungen sammeln – und nicht aufgeben
Am Ende ist Motivation nicht nur das Feuer am Anfang, sondern auch die Glut, die bleibt. Sie zeigt sich besonders dann, wenn es schwer wird – wenn Rückschläge kommen, wenn das Ziel in weiter Ferne liegt, wenn man sich fragt: „Wofür das alles?“
Gerade dann lohnt es sich, weiterzumachen. Nicht stur, nicht blind – sondern lernend. Erfahrungen sind der Rohstoff für echte, dauerhafte Motivation. Denn mit jedem Schritt wächst das Vertrauen: „Ich schaffe das.“
Und manchmal – auch das gehört zur Wahrheit – ist eine Pause keine Kapitulation, sondern ein strategischer Boxenstopp. Danach weiterzumachen, ist keine Schwäche, sondern Stärke.
Fazit: Motivation ist kein Dauerzustand – sondern ein Prozess
Du wirst nicht jeden Tag motiviert sein. Niemand ist das. Aber du kannst dir Strukturen schaffen, die dich auch dann tragen, wenn deine Motivation gerade Urlaub macht.
- Setz dir klare, realistische Ziele
- Schaffe Rituale und Routinen
- Hol dir Inspiration von außen
- Sei mutig und neugierig
- Erlaube dir Pausen – und Rückschläge
- Und vor allem: Bleib dran
Denn Motivation ist kein Geschenk – sie ist das Ergebnis deines Handelns . Und manchmal beginnt alles mit einem ganz kleinen Schritt. Vielleicht heute. Vielleicht jetzt.
Warten Bis(s) ...
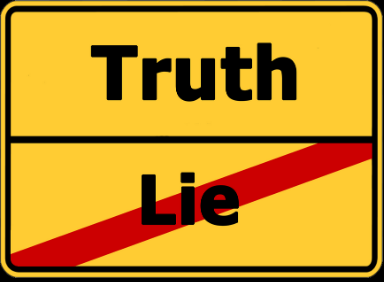
Einleitung allgemeiner Teil:
Geheimnisse und Lügen gehören zu den destruktivsten Elementen zwischenmenschlicher Kommunikation. Was auf den ersten Blick wie ein Schutzmechanismus wirken mag – etwa um jemanden nicht zu verletzen oder sich selbst zu schützen – entwickelt sich oft zu einem komplexen Netz aus Unwahrheiten, das die Realität zunehmend verzerrt. Der Satz „Geheimnisse werden zu Lügen, Lügen werden geheim gehalten. Das tatsächliche Problem ist nicht zu erkennen. Also wird versucht, an Problemen zu arbeiten, die auf Lügen basieren. Also kann nicht geholfen werden.“ bringt dieses Dilemma auf den Punkt. Er beschreibt eine gefährliche Dynamik: Wenn Probleme nicht ehrlich benannt werden, bleibt der Kern des Konflikts im Dunkeln. Dadurch werden Lösungsversuche unbrauchbar, da sie auf falschen Informationen beruhen. Die Wahrheit wird verborgen, und jede daraus abgeleitete Handlung kann nur ins Leere laufen. In dieser Analyse sollen die zentralen Aussagen dieses Gedankens beleuchtet, die daraus resultierenden negativen Erfahrungen erläutert und abschließend reflektiert werden, warum Ehrlichkeit eine grundlegende Voraussetzung für echte Veränderung ist.
Erklärung der negativen Erfahrungen:
Der erste Teil des Satzes – „Geheimnisse werden zu Lügen, Lügen werden geheim gehalten“ – zeigt, wie schnell sich Verschwiegenheit in aktive Täuschung verwandeln kann. Ein Geheimnis kann irgendwann nicht mehr passiv bestehen bleiben, es verlangt oft nach einer Ergänzung, einer Ausrede, einer Geschichte – einer Lüge. Diese wiederum muss geschützt werden, wodurch neue Geheimnisse entstehen. Es entsteht ein Kreislauf, der nicht nur das Vertrauensverhältnis zwischen Menschen zerstört, sondern auch innere Spannungen und psychische Belastungen erzeugt. Wer lügt, lebt ständig mit der Angst, entlarvt zu werden. Wer angelogen wird, spürt oft instinktiv, dass etwas nicht stimmt, auch wenn er es nicht konkret benennen kann.
Schlimmer noch ist die Tatsache, dass in einer solchen Situation der Zugang zur eigentlichen Problematik verloren geht – „Das tatsächliche Problem ist nicht zu erkennen“. Stattdessen werden Symptome behandelt, falsche Ursachen angenommen oder oberflächliche Lösungen gesucht. Besonders in persönlichen Beziehungen, aber auch im beruflichen oder gesellschaftlichen Kontext, führt dies zu Frustration. Man fühlt sich missverstanden, nicht gehört oder scheitert immer wieder an den gleichen Mustern. Doch das Scheitern liegt nicht in der Unfähigkeit der Beteiligten, sondern in der falschen Basis, auf der gehandelt wird.
Der letzte Teil – „Also wird versucht, an Problemen zu arbeiten, die auf Lügen basieren. Also kann nicht geholfen werden.“ – bringt die Tragweite dieser Dynamik auf den Punkt. Hilfe setzt Klarheit voraus. Wo keine Ehrlichkeit herrscht, kann auch keine wirksame Unterstützung stattfinden. Hilfe, die sich auf eine Lüge stützt, ist nicht nur wirkungslos, sondern kann die Situation noch verschlimmern, weil sie den wahren Schmerz oder das eigentliche Thema überdeckt.
Zusammenfassung erster allgemeiner Teil:
Geheimnisse und Lügen sind keine harmlosen Begleiter menschlicher Interaktion, sondern können sich zu massiven Hindernissen in der Problemlösung und im zwischenmenschlichen Verständnis entwickeln. Der zitierte Gedankengang zeigt auf, wie Lügen eine falsche Realität erschaffen, die jede Form von echter Hilfe verhindert. Nur durch Offenheit, Ehrlichkeit und den Mut, die Wahrheit auszusprechen – auch wenn sie unangenehm ist – kann wirkliche Veränderung geschehen. Wer sich weigert, die Wahrheit zu zeigen, verweigert sich nicht nur selbst die Möglichkeit zur Heilung, sondern auch denen, die helfen wollen. In einem solchen System aus Verschleierung und Täuschung bleibt das eigentliche Problem unerkannt – und damit unlösbar.
Einleitung: Die Bedeutung von Wahrheit in der therapeutischen Arbeit
In einer therapeutischen Beziehung ist Offenheit die Grundvoraussetzung für jede Form der Heilung. Psychotherapie lebt vom Vertrauen zwischen Therapeutin und Klientin, vom ehrlichen Austausch über Gedanken, Gefühle und Erfahrungen. Doch was passiert, wenn dieser Austausch nicht auf Wahrhaftigkeit beruht? Der Satz „Geheimnisse werden zu Lügen, Lügen werden geheim gehalten. Das tatsächliche Problem ist nicht zu erkennen. Also wird versucht, an Problemen zu arbeiten, die auf Lügen basieren. Also kann nicht geholfen werden.“ verdeutlicht die Tragweite, die Unehrlichkeit in einer therapeutischen Beziehung annehmen kann.
Dieser Gedanke beschreibt eine Abwärtsspirale: Geheimhaltung wird zur Lüge, die wiederum neue Geheimnisse produziert. Die eigentliche Problematik bleibt unerkannt, und die Therapie setzt an falschen Punkten an. In der Folge entstehen Missverständnisse, Stagnation und Frustration – sowohl auf Seiten der Klientinnen als auch der Therapeutinnen. Im Folgenden wird diese Dynamik in vier Abschnitten systematisch analysiert.
1. Geheimnisse in der Therapie – Schutz oder Hindernis?
Viele Menschen treten mit Unsicherheiten oder Angst in eine Therapie ein. Es fällt ihnen schwer, über bestimmte Erlebnisse oder Gedanken zu sprechen – sei es aus Scham, Schuldgefühlen oder mangelndem Vertrauen. In solchen Fällen entstehen Geheimnisse: Informationen werden zurückgehalten, obwohl sie eigentlich zentral für das Verständnis der psychischen Belastung wären.
Diese Zurückhaltung ist zunächst menschlich und verständlich. Doch sie kann problematisch werden, wenn sie dauerhaft bestehen bleibt. Wird ein Geheimnis über einen längeren Zeitraum nicht nur verschwiegen, sondern durch Ausreden oder Falschangaben ersetzt, entsteht daraus eine Lüge – bewusst oder unbewusst.
2. Lügen und die Illusion eines „funktionierenden“ Therapieverlaufs
Lügen in der Therapie erzeugen eine falsche Realität, auf deren Grundlage der/die Therapeutin zu handeln versucht. Vielleicht beschreibt der/die Klientin ein bestimmtes Verhalten, das gar nicht stattfindet, oder verschweigt entscheidende Beziehungsdynamiken. Die therapeutische Analyse wird dadurch verfälscht.
Die Folge ist, dass scheinbar Fortschritte gemacht werden – doch diese betreffen nicht das eigentliche Problem. Stattdessen wird ein „Ersatzproblem“ behandelt. Klientinnen wundern sich, warum sie trotz regelmäßiger Sitzungen keine wirkliche Verbesserung spüren. Therapeutinnen wiederum erleben, dass Interventionen ins Leere laufen, ohne den wahren Grund dafür zu erkennen.
3. Wenn das eigentliche Problem unsichtbar bleibt
Der zentrale Gedanke des Zitats zeigt sich in diesem Punkt besonders deutlich: „Das tatsächliche Problem ist nicht zu erkennen.“ Wenn Informationen fehlen oder verzerrt sind, entsteht ein blinder Fleck – das tatsächliche Leiden, das zugrunde liegende Trauma, die echten Konflikte bleiben im Verborgenen.
Dieser Zustand kann lange andauern. Er kostet viel Zeit, Energie und Vertrauen. In manchen Fällen entwickeln Klient*innen sogar das Gefühl, dass Therapie „nicht hilft“, obwohl sie eigentlich nicht die richtige Basis hatte, um helfen zu können. Diese Erfahrung kann zusätzlich entmutigen und zu einem Rückzug aus dem therapeutischen Prozess führen.
4. Warum auf Lügen basierende Hilfe nicht funktionieren kann
Ein besonders tragischer Aspekt ist der letzte Satz: „Also kann nicht geholfen werden.“ Denn damit wird deutlich: Der Wille zur Veränderung ist vielleicht vorhanden, der Wunsch nach Hilfe ehrlich – aber ohne Wahrheit bleibt dieser Wunsch unerfüllbar.
Therapeut*innen sind darauf angewiesen, mit den Informationen zu arbeiten, die ihnen gegeben werden. Sie können keine Gedanken lesen. Wenn diese Informationen jedoch manipuliert oder beschönigt sind, wird Hilfe zur Illusion. Die therapeutische Arbeit verfehlt ihr Ziel – nicht aus Unfähigkeit, sondern aus fehlender Grundlage.
Zusammenfassung: Ehrlichkeit als Schlüssel zur Veränderung
Therapie ist ein geschützter Raum, in dem Heilung geschehen kann – aber nur, wenn dieser Raum mit Ehrlichkeit gefüllt wird. Geheimnisse und Lügen sabotieren diesen Prozess still und schleichend. Sie lassen das eigentliche Problem unerkannt und verhindern wirksame Hilfe.
Der analysierte Gedanke bringt diese Dynamik klar und prägnant auf den Punkt. Er macht deutlich: Auch wenn es Mut und Vertrauen braucht, ist Ehrlichkeit der einzige Weg, um psychische Heilung zu ermöglichen. Ohne sie bleibt jede therapeutische Intervention nur ein Versuch, die Fassade zu stabilisieren – während das Fundament weiter bröckelt.
Die Quintessenz der Unterstützung ist die Ehrlichkeit.
Meine Erfahrungen mit anderen ...
... und mir selbst.
Ossy